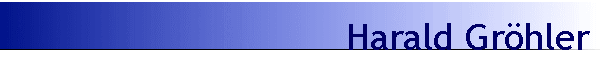|
Als Schriftsteller - Buchautor, Theaterautor - sehe ich eine Inszenierung unwillkürlich immer in zweierlei Weise, und ich denke, das ist naheliegend. Ich bin einerseits ganz
gewöhnlicher Zuschauer, und gleichzeitig versuche ich an die Machart des Stückes, das ich sehe, heranzukommen. Beim Weißen Rößl
bin ich damit sowieso nicht allein: seit jeher wird versucht, das Geheimnis seines Erfolges zu lüften.Im weißen Rößl, soviel habe ich rasch gemerkt, ist raffiniert gebaut, schon von der Art und Weise her, wie
die Knoten geschürzt sind, und es ist kein Zufall, daß das Stück ins Amerikanische, ins Französische, ins Italienische übersetzt, mehrmals verfilmt wurde und über siebzig Jahre, um nicht zu sagen hundert Jahre
(Uraufführung der Vor-Fassung: 1898) in den Spielplänen immer wieder erscheint. Das liegt nicht nur an den Schlagern, den Evergreens. Die haben die Mindener hübsch entstaubt, will sagen auch für junge Ohren im Jahr
2001 wieder neckisch und munter hörbar gemacht. Sogar Charlestonrhythmen - habe ich mich doch nicht verhört? - und Charlestonfiguren, die jedenfalls, entdecke ich, Jazzrhythmen ohnehin, Swingelemente dito. “die
Mindener”: im Klartext dürfte das auf die Leistung von Pit Witt, dem musikalischen Leiter, zurückgehen. Ihm plus Orchester, natürlich. Plus Regisseur (Andreas Lachnit) und Choreographin (Angela Hercules Joseph),
sicherlich. Plus Ensemble, soweit das jeweils die Schlager schmettert (mehr als anderthalb Dutzend Schlager, “Die ganze Welt ist himmelblau”, “Eine Kuh so wie du”, “Was kann der Sigismund dafür, daß er so schön ist” -
dies zum Beispiel wirklich schmissig und wie neu hingelegt vom Klärchen und eben dem Sigismund) Aber nein, das ist nur die Hälfte des Erfolgs. Und daß dieses Ensemble sehr gut spielt, erklärt auch nicht den ganzen
Erfolg; den Sukzeß, den viele und ganz verschiedene Ensembles durch die Jahrzehnte hin ja immer wieder eingespielt haben. An die Ereignisse der Handlung kommt der Zuschauer über einen lateralen Einstieg heran. Nicht
die Hauptpersonen agieren zunächst vor dem Gasthof am Wolfgangsee, sondern ein Piccolokellner (Patric Tavanti, nicht schlecht!), ein Oberförster (Siegmar Tonk) und die Christl von der Post, Briefträgerin, tauen das
Publikum auf. Alles weist in diesen ersten Augenblicken zielstrebig auf etwas Weiteres, Folgendes hin, alles ist Auftakt, wir werden neugierig gemacht. daß dann später die eine Person dramaturgisch immer wieder wichtig
sein wird - der Piccolokellner -, ist eine der trickreich-geschickten Volten des Stückes. Man erwartet im Sommerfrische-Gasthof neue Gäste: es kommen mit dem Dampfer nicht einfach Gäste an, sondern die werden
erwartet, der Vorgang wird so “psychisiert”. Die Gäste trudeln ein, und im Handumdrehen - gekonnt! - werden ganze Schicksale vor dem Zuschauer ausgebreitet. ... Aber eben nicht nur das. Sondern die Schicksale werden
auch sofort neu verzahnt, sie werden weitergedrückt, der Hemdhosen(!)fabrikant Wilhelm Giesecke ist mitten in einer existentiell-bedrohenden Auseinandersetzung mit seinem Kontrahenten begriffen - Berlin contra
Sangershausen -, und damit der Zuschauer nur nicht von seinem Sex-losen Unternehmer angeödet wird, ist der Herr Giesecke (Jürgen Morche: Überzeugend) zusammen mit seiner heiratsfähigen Tochter Ottilie (Susanne Eisch;
pfiffig antwortend und zugleich immer sehr weiblich; mit vielsagendem, aussagekräftigem Mienenspiel über das ganze Stück hin, was im späteren Verfolg ihrer Rolle oft nur ihrer eigenen, sensiblen Interpretation
überlassen bleibt und gar nicht leicht sein dürfte) angereist gekommen. Seine Gegenspieler werden dann auch nicht ein fader Senior, sondern der fesche, heiratsfähige Sohn Sigismund Sülzheimer (Siegmar Tonk) des
Kontrahenten und vor allem der gegnerische, jugendliche Anwalt Dr.Siedler (Christoph Banken) sein. Daß dies zufällige Zusammentreffen der Gegner exakt im selben Gasthof im fernen österreichischen Salzkammergut
eigentlich unwahrscheinlich wäre, stört in einem revue-artigen Singspiel kaum, in einem Musical gleichermaßen wenig, weder 1930 noch 2001; hier werden laschere Maßstäbe angelegt als bei einem High-level-Roman. Die
Autoren des Stückes - es sind insgesamt mehr als ein halbes Dutzend (zunächst Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg, dann Hans Müller, Robert Gilbert, Bruno Granichstaedten, Robert Stolz; schließlich auch noch Erik
Charell und Ralph Benatzky)! - haben den konstruktiven Schwachpunkt aber anscheinend sogar empfunden und ihn ein wenig abzumildern versucht: Zunächst ist von der gegnerischen Seite nur ein Parteigänger, der
Rechtsanwalt, mit auf dem Plan. Der Anwalt will seinen Mandanten, den Sangershauser Unternehmer, hierherlotsen, und dadurch, daß dieser Vorschlag nicht so glatt erfüllt wird (Mandant schickt nur seinen Sohn, kommt nicht
selbst), wird jener Schwachpunkt des Handlungsablaufs noch weiter in der Aufmerksamkeit des Zuschauers ausgeblendet. Auf bemerkenswerte Weise lassen die Autoren des Stückes große, weitreichende Perspektiven und
Augenblicks-Hickhack ineinanderrutschen. Beides changiert ineinander, im Genre des Musicals wird beides gleichgewichtig. Fabrikant Giesecke bekommt das beste Zimmer im Gasthof - durch den Zahlkellner (Kay Rode) -;
Giesecke soll das beste Zimmer sofort wieder räumen für den gegnerischen Anwalt, und hierbei sind geschickt weitere Motivlagen mit eingebaut. Die Wirtin (Katja Brauneis; günstigerweise eine echte Wienerin) würde sich
gern einmal an der Seite des Anwalts sehen, dem Anwalt reserviert sie deshalb eisern das schöne Balkonzimmer; der Zahlkellner hintertreibt das, denn der Zahlkellner möchte sich selber mit der Wirtin liieren und will den
Rivalen gerne vor den Kopf stoßen und fortdrängen. Giesecke, der sich aus dem Zimmer geschmissen sieht, wird sauer - das ist nachvollziehbar, und die leichte Operettenhandlung erhält so auch etwas mehr Ernsthaftigkeit
und Gewicht. Das Stück steht und fällt meines Erachtens mit dem Auftakt, mit den eingeleiteten Verwicklungen. Hinterher, im zweiten Teil, kommen dann in der Hauptsache lauter Paare zustande; vollkommen genre-mäßig.
Ich finde den ersten Teil des Stückes auch stärker als den zweiten; aber bis zum Ende des ersten hat das Publikum ja auch schon längst angebissen, hat sich ein festes Urteil schon gemacht; die Autoren des Stücks können
dann dem Publikum nach aller unruhigen Verwirrungen des ersten Teils auch mehr “Muße” (und die vielen Happy-end’s) erlauben. Die Achse des Stückes ist die Beziehung, die Nichtbeziehung zwischen dem verliebten
Zahlkellner und seiner Chefin, der verwitweten, noch einigermaßen jungen “Rößl”-Besitzerin. Es ist die Achse, weil dieses Problemverhältnis über die längste Zeit des Stückes hin konstant bleibt und der Zuschauer hier
immer wieder auf ihm Vertrautes stößt, - Wiedererkennungseffekt. Das Verhältnis, das sich über weite Strecken hindurchzieht, wird immer wieder überraschend gemacht. Zum Beispiel durch Ohrfeigen. Die die Chefin dem
schmachtenden Zahlkellner in sozusagen regelmäßigen Abständen austeilt. Der Regisseur der Mindener Inszenierung hat - bewußt? Unbewußt? - voller Fingerspitzengefühl dieser Achse Rechnung getragen. Ein anderer Fixpunkt
des Stückes ist für den Zuschauer der Auftritt des Kaisers Franz Josefs II. (Walter Rommelmann`s). So wie ich es empfand, ist die ganze Kaiserzutat ein souverän eingefügter ... Fremdkörper. (Jetzt nach der Aufführung
erfahre ich: schon andere Kritiker früher empfanden den Kaiser als Deus ex machina
für das Stück.) Freilich muß man sich klarmachen: 1930, nach der demontierten Monarchie in Deutschland wie in Österreich, war dieser Kaiser-Eintritt noch weit mehr “Knaller” als im Jahr 2001. Zarte Ironie, gelinder, wohlwollend-liebevoller Spott umflirrt diesen Kaiser-Gag heute, und solch leicht spöttische, augenzwinkernde Ironie ist einem Musical durchaus adäquat.
Überhaupt hält Andreas Lachnit viele Bonbons bereit. Ich sehe hier den Fachmann am Werk, der das Publikum Minute für Minute vor Distanziertheit und Unbeteiligtheit bewahrt; und die drohen beim fernsehgewohnten
Zuschauer von heute immer. Das Publikum soll keine Chance haben, etwa innerlich abzuschalten: Die vielen Ohrfeigen des Stückes tragen zum Beispiel dazu bei - und ich habe mir hinterher von mehreren Schauspielern
erzählen lassen, die Backpfeifen tun zum Teil wirklich weh, und die dicht hinterm Vorhang lauernden Mit-Schauspieler sind von dem schon gespannt erwarteten und dann so heftigen Schall der nächsten Maulschelle wirklich
oft entsetzt. Ebenso trägt dazu bei, wie die Christl von der Post (Anja Hackl), die sowieso Feuer hat, im einen Fall von der Bühne herunter und am Orchestergraben die gesamte erste Publikumsreihe entlangstürmt - die
Zuschauer müssen die Hessen, Pardon, Beine einziehen -; oder wenn die Akteure vom vordersten Publikums-Zugang her auftreten und schon hier ihren Rollentext sprechen. Ein Höhepunkt, was Aktivierung des Publikums anlangt,
ist es für mich, wenn Klärchen (Vanessa Wilcek), die - ebenfalls knapp heiratsfähige - Tochter des Privatgelehrten, den Unternehmerssohn anmacht, schämen soll er sich, über sie, die lispelt, zu lachen, und Vanessa
Wilcek sofort direkt zum Publikum gewendet, das darüber nur lacht, hinzufügt: “... Und Sie auch!” Ein Einwurf, den das köstlich schüchterne Klärchen nur geistesgegenwärtig und reaktionsschnell bringt, sofern das
Publikum in der Aufführung wirklich gerade losgeprustet hat. Durch viele solche Einfälle ist diese Inszenierung so lebendig ausgefallen. Im zweiten Teil gegen Ende des Stücks, gibt es, ich deutete es schon an, dann
lauter Paare: Klärchen und Unternehmersssohn, Tochter Giesecke und gegnerischer Anwalt, Wirtin und Zahlkellner. Der übersüße Pärchen-Effekt ist aber von den Autoren des Stückes erträglicher gemacht worden: unter anderem
durch gewisse Überraschungsreaktionen wenn schon nicht beim Publikum, so doch bei den Personen des Stücks: der Vater Giesecke hat die Tochter lieber dem gegnerischen Unternehmerssohn geben wollen, der pottarme
Privatgelehrte fällt über das sich anbahnende Schicksal seiner Tochter bald in Ohnmacht, die Wirtin springt mit ihrer endgültigen Partnerwahl über ihren eigenen Schatten und hat den Rezensenten, mich, hier am meisten
verblüfft. Ein von den Rößl-Autoren gekonnt ausgereiztes Kunstmittel war, als sie die Dialoge gestalteten, die Wiederholung. Der Kaiser, der bei x Gelegenheiten resümiert, “es war sehr schön. Es hat mich sehr
gefreut” - Bemerkung, die die Autoren übrigens dem wahren Franz Josef II. einst nur abzulauschen brauchten -,oder Gieseckes vielmaliges “Et is mir liiieba. Ahlbeck is ma lieba!”: das sind Merkmale die man aus dem Stück
nachher sogar herausträgt und die im Stück sehr viel Wirkung entfalten. Es ist zu sehen: der Wiedererkennungswert von Sätzen oder ganz allgemein von Bezügen ist hier in dem Stück eine feste Größe. Durch solche
Wiedererkennungseffekte werden die zeitweise ans Quirlig-Chaotische reichenden Verwicklungen der Handlung kompensiert, werden “Verschnaufpausen” geschaffen. Über schon vertraut gewordene Bemerkungen, über “vertrautes
Gelände”, sind ein wenig ältere Zeitgenossen immer sehr erfreut. Und sowieso fühlen sich von einer Aufführung “Im Weißen Rößl”
heute speziell mittlere und ältere Semester angezogen; ein Zusammentreffen, das sich im Jahr 2001 ganz ungesteuert von selbst ergibt. Aber ich sah auch genug junge Leute im Publikum - die Tochter mit der Mutter zum Beispiel -. Ein Stück, das seit siebzig Jahren nicht totzukriegen ist, muß naturgemäß Vertreter aller Altersstufen anziehen.
|